3 Tage auf einem Frachtschiff. So lange dauerte es, um von Tahiti nach Fakarava zu kommen. Während ich bei meiner Ankunft einem Freund Medizin für seinen Fuß gebracht habe, lernte ich dessen Nachbarn kennen: Mana. Der war zufällig Bootskapitän bei der Tauchschule „Topdive“. Und so entstand auch diese verrückte Idee. Ob er denn eine kleine, einsame Insel kenne, wo kein Signal ist, niemand lebt und auch niemand vorbei kommt, fragte ich ihn. Und ob er mich dorthin bringen könne. Nur einen Anspruch hatte ich: Kokospalmen sollte es dort geben. Mehrfach sagte Mana, dass das kein Problem sei. Noch öfters fragte er mich jedoch, ob ich mir meines Vorhabens gewiss bin…

Vorbereitung für das Inselleben
In meiner ersten Fakarava-Woche nahm ich gelegentlich Unterricht: Manas Frau zeigte mir, wie man sich aus Kokosblättern seine Kleidung macht – schließlich wollte ich mich für meine neue Insel zurecht machen. An anderen Tagen brachte mir Mana das Speerfischen bei. Bei Tageslicht unter Wasser, nachts auf dem Riff. Die meiste Zeit war ich jedoch mit Kokosnüssen beschäftigt. Wohlwissend, dass sie demnächst meine Lebensquelle sein werden. Und nach 1 Woche war es schon so weit. Mit dem Boot brachte mich Mana zum Tauchparadies Fakarava Sud. Von dort wateten wir gemeinsam durch die schmale Rifflagune und über mehrere Inseln – einige sind in Privatbesitz, andere unbewohnt – zu meiner neuen Heimat. Bei unserer Verabschiedung verständigten wir uns auf 5 Tage. Uns beiden war klar, wie lebenswichtig seine Ankunft für mich dann sein werden würde.

Tag 1
Mana ist weg. Ich sehe mich um. Die Schönheit dieser Insel umspannt kein Verstand. Schön und rau zugleich. Einigen Palmen fehlen die Blätter. Perfekte Imperfektionen. Woanders hätte ich vielleicht Menschen, oder ein Schiff sehen können. Hier nicht. Einmal im Leben will ich erfahren, was völlige Isolation bedeutet. Physisch und psychisch. Ich habe nicht einmal eine Uhr. Was ich mir für den Notfall mitgenommen habe, falls ich 5 Tage lang nichts zu essen und trinken finde: 2 Dosen Bohnen, 3 Liter Wasser. Deshalb waren Kokosfrüchte bei meiner Inselwahl mein einziger Anspruch. Weitere Utensilien: Zelt, Handtuch, Messer, Machete, Sandalen, Kamera, Taschenlampe, Zahnbürste. 5 Tage, 4 Nächte. Ein Experiment. Von mir. An mir. Mit mir. Für mich.

Zuerst baue ich mein Zelt auf. Befreie den Zugang von messerscharfen Korallensplittern. Wie gut, dass ich meine Sandalen dabei habe. Jetzt bin ich angekommen. Alle Sinne auf Empfang. Ich schließe Bekanntschaft mit Familie Krebs. Ich begrüße das Meer und jede Palme. 63, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ein Rundgang um die Insel, dafür benötige ich ca. 20min. Die Kokosnüsse, die ich unterwegs gefunden habe, lege ich auf die Korallensteine vor meinem Zelt. Sie sind mein Frühstück und meine Milch für morgen. Abends füge ich mich in die Idylle, die nichts verspricht und alles hält. Meine Faulheit freut sich und gedeiht. Sie legt sich in den Schatten. Die Luft nehme ich stillatmend ein. Pure Freude und Entspannung. Mein Blickfeld: Kokospalmen. Sonnenstrahlen spinnen sich von Palme zu Palme. Langsam wird es dunkel. Der rote Feuerball am Horizont verschwindet. Nur wenig später erscheint bereits das nächste Fernlicht. Wie ein Butterfleck hängt er gelblich glimmernd am Himmel: es ist Vollmond. Schlafenszeit.

Tag 2
Seit 3 Stunden bin ich schon wach. Es dürfte 8 Uhr morgens sein. Träge fließen die Momente. Ich blicke zur gleißenden Sonne hoch. Es ist feuchtheiß. Mein Zelt ist nass. Die Luft drückt bereits auf meine Lungenflügel. Es gibt kaum Schatten auf meiner Insel. Das Aufschlagen der ersten Kokosfrucht dauert lange. Als meine Lippen ansetzen, um daraus zu trinken, schmecke ich gegorenes Wasser. Dazu hat mich Mana schon vor 2 Tagen lächelnd ermutigt: „Schmeckt wie warmes Sprite.“ Gut für das mentale Stehvermögen. Aber viele Schluck werden es nicht. Wenige Zeit später: Die Sonne sticht. Es ist so heiß. Ich halte dagegen. Das Meer hätte ich eigentlich als Abkühlung eingeplant. Jetzt wird mir klar, dass ich darin nicht schwimmen kann. Das Riff ist messerscharf und ohrenbetäubend krachen die pazifischen Wellen darauf. Zu gefährlich. So bleiben mir nur knietiefe, warme Lagunen übrig, durch die sich manchmal ein kleiner Hai schlängelt.
Langsam aber sicher werde ich krank. Alles dreht sich plötzlich. Dehydration. Schwindel. Ich bekomme kaum Luft. Mein Herz schlägt schnell und schneller. Nach irgendjemand zu suchen und Hilfe holen ist zwecklos. Wohin sollte ich denn gehen?! Ich bin auf einer winzigen Insel in einem Atoll mitten im Pazifischen Ozean. Hier gibt es kein Signal. Ich werde verrückt. Eine Panikattacke. Ich schreie. SCHREIE. Ein lautes: „Aaaah!“ Lauter. Am lautesten! Alles schreie ich aus mir heraus! Mir wird schwarz vor Augen.
Jetzt ruft meine Angst die Vernunft zurück. Ich muss handeln: Erschöpft schleppe ich mich mit schweren Schritten zum Meer. Abkühlen. Vorsichtig taste ich mich nach einem möglichen Meereseinstieg ab. Hände und Beine beginnen zu bluten, habe mich etwas am Riff aufgeschnitten. Jetzt. Endlich: Wasser. Abkühlung. Und schnell zurück in den dünnen Palmschatten. Hinlegen. Ich schließe die Augen. Gedankenrasen. Stürme, nein, Orkane von Gedanken. Es ist erst Tag 2. Wie soll ich das bloß 5 Tage lang aushalten?
So gerne will ich wieder Menschen sehen. Bitte. Irgendjemand. Ein Vogel landet vor mir. Oder in meinem Kopf? ‚Was hast Du mir denn jetzt zu sagen?‘ Ich werde verrückt. Glaube ich. Ein Lied aus meiner Zeit im Kindergarten taucht aus meinem Unterbewusstsein auf: ‚Warum nur warum?‘. Irgendwann bin ich eingeschlafen. An Tag 2 habe ich sonst keine weiteren Erinnerungen.

Tag 3
Ich denke an gestern. Realitätsschock gepaart mit Krankheit – das hat diese Panikattacke ausgelöst. Romantisierende Vorstellungen von einer einsamen Insel mögen schön wirken. Die Realität vor mir ist jedoch knallhart, scharf, feuchtheiß und schmeckt entweder verdorben oder versalzen. Rückblickend ein Gewinn. Dass mir nämlich niemand sonst hier helfen kann, rückt neue Tugenden in den Vordergrund: Demut, Organisation, Selbstständigkeit. Vor allem offenbart sich hier ein essentieller Lernprozess: dankbar und zufrieden zu sein, mit dem, was man gerade hat. Und stets das beste aus seiner Lage zu machen.
Heute reicht mir die Ruhe ihre Hände. Dabei ist ja Ruhe eigentlich nicht mehr in Mode. Dieses Modell ist in unserer Leistungsgesellschaft ausgelaufen. Zugegeben, das war es auch für mich. Immer etwas schaffen, immer etwas leisten, um Bedeutsamkeit zu erfahren. Im Gegensatz zu gestern kommt heute das Phänomen der Langeweile jedenfalls nicht mehr auf. In westlichen Kulturen glaubt man ja, wenn man nichts tut, seine Zeit nicht genutzt zu haben. Dann führt die eigene Rastlosigkeit zur Ratlosigkeit. Einfach weil man sich plötzlich mit jemand beschäftigen muss, mit dem man sich nie wirklich beschäftigt hat: sich selbst. Hier komme ich mir selbst auf die Spur. Insofern begreife ich diese Tage als Mentaltraining deluxe. Der Wind weht. Und mit ihm meine Gedanken fort. Heute ist ein guter Tag.

Tag 4
Steinzeit. Ich bin Jäger und Sammler. Sammle Kokosfrüchte. Jage Fische. Mache Feuer mit getrockneten Kokosschalen. Einsam? Vor zwei Tagen war ich vielleicht der einsamste Mensch der Welt. Der Grund warum sich Menschen einsam fühlen ist nicht, weil sonst niemand da ist. Sondern weil sie nicht in Harmonie mit sich selbst sind. Und wenn sonst niemand da ist, sind sie einsam mit ihrem Feind: sich selbst. Heute ist das aber nicht so. Mein Glücksbarometer ist bestimmt nicht auf höchster Stufe. Nach wie vor ist das Leben hier knallhart, scharf, feuchtheiß und schmeckt entweder verdorben oder versalzen. Aber ich erfreue mich zutiefst daran, wie viel auf dieser kleinen Insel tatsächlich passiert. Man muss nur die Geduld haben, zuzusehen und zuzuhören.
So wurden etwa meine aufgeschlagenen Kokosfrüchte bereits von Krebsen kolonialisiert. Und ich sehe ihnen zu. Kleinere Krebse, die es nicht auf Anhieb ins Innere der Schale schaffen, helfen sich gegenseitig. Solidarisch bilden sie eine Krebsbrücke hinauf zum Kokoskrater, sodass auch andere Krebse vom Süßwasser kosten können. Etwas später landet ein Braunfußtölpel auf der Insel. Früher hätte ich den wohl gar nicht bemerkt, und ihm schon gar nicht meine ganze Aufmerksamkeit gewidmet. Wenn man aber 3.000km östlich auf den Galapagos-Inseln schon Blaufuß- und Rotfußtölpel gesehen hat, ist man vollständig beeindruckt. Hier hat ihnen Mutter Natur also eine andere Schuhfarbe geschenkt: braun. Im Sand liegend blicke ich mit einem Lächeln auf die Wasserwüste vor mir.

Tag 5
Hoffentlich holt mich Mana ab. Meine Wasserflaschen sind leer. Die Bohnen auch. Aber ich muss nicht lange hoffen. Schon höre ich ihn rufen. Was für eine Freude! Wir umarmen uns. Selten habe ich mich so über ein Wiedersehen gefreut. Wir sagen uns nichts. Welche Worte würden jetzt schon eine Bedeutung haben?! Ich lächle. Und blicke zu ihm. Auch er lächelt. Mit seinem Boot fahren wir 1 Stunde zurück in den Norden des riesigen Fakarava-Atolls. Jetzt gehe ich wieder auf einer Straße. Ich setze mich wieder auf einen Stuhl. Am Tisch reicht man mir Messer und Gabel. Ich staune! Wie praktisch diese Erfindungen des Menschen sind. Und wie schön es ist, wieder unter Menschen zu sehen.
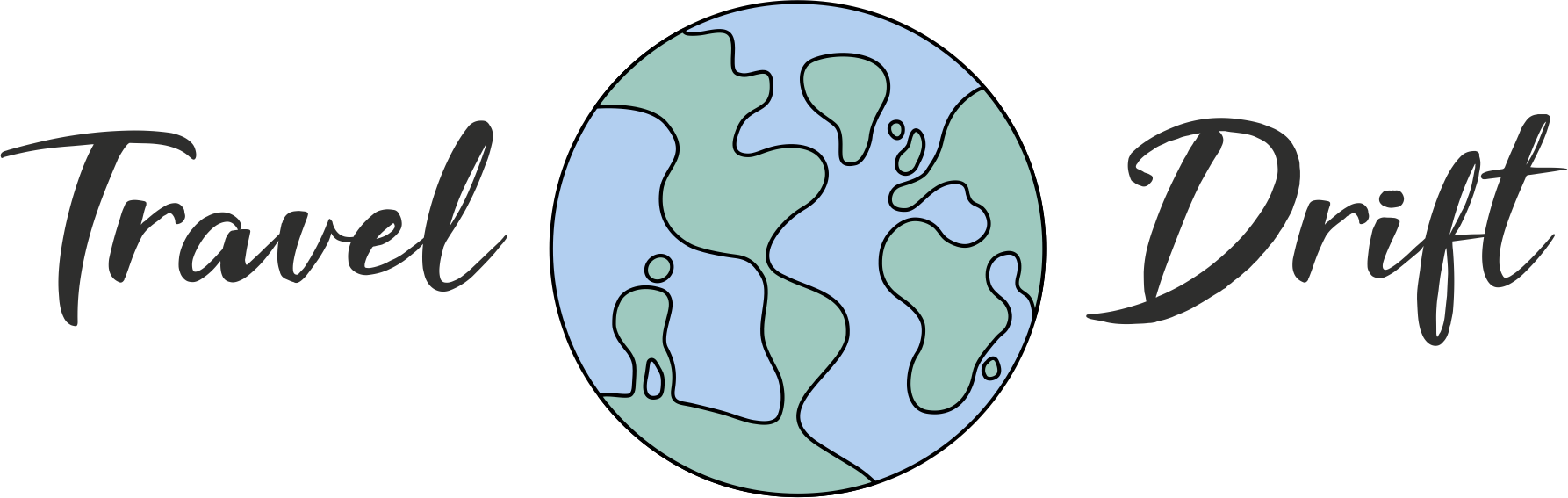








Hinterlasse einen Kommentar