[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Einmal den höchsten Punkt der Erde sehen: den Mt. Everest. Nicht unbedingt besteigen. Aber sehen. Das war mein Wunsch. Und dafür bereitete ich mich bestens vor. Ich studierte alles über Höhenkrankheit und ihre Symptome. Auf keinen Fall wollte ich zu jenen zehn Menschen pro Jahr gehören, die im Schnitt auf dem Weg zum Everest-Basislager sterben. Statt möglichen sieben, buchte ich deshalb zehn Wandertage mit einem erfahrenen Bergführer. Außerdem hatte ich über eine spezielle Versicherung Anspruch auf eine Hubschrauberbergung, falls ich tatsächlich in lebensbedrohliche Schwierigkeiten kommen sollte. Das Abenteuer war angerichtet. Und ich in bester physischer Verfassung.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”21476″ img_size=”large” add_caption=”yes” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Atmen durch den Strohhalm” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Tengboche. Von Lukhla startend waren die ersten fünf Wandertage im Sagarmatha Nationalpark einfach nur genial. Unzählige Wasserfälle, reißende Flüsse, schneebedeckte Himalaya-Berge, prächtige Vögel und vor allem die spannende Bergkultur der Sherpas. Heute morgen in Namche Bazar konnte ich sogar das absolute Highlight für immer in meinem Gedächtnis abspeichern: Ich sah den Mt. Everest. [/vc_column_text][vc_column_text]Und nun war ich nach der heutigen Tagesetappe rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit im Bergdorf Tengboche angekommen. Mit 9,2 Kilometern Fußmarsch, 600 Höhenmeter Aufstieg, 62% Sauerstoffgehalt und einem 11kg-Rucksack war ich nun auf 3.860m über dem Meeresspiegel doch relativ erschöpft. Für vier Euro kann man eine heiße Dusche nehmen, stand jedenfalls auf einem Schild in meiner Unterkunft. Bekommen habe ich zwei kleine Eimer mit lauwarmen Wasser. Das bewirkte das Gegenteil. Ich begann zu frieren. Den ganzen Abend. Auch das Schlafen funktionierte nicht. Zum ersten Mal in meinem Leben erlebte ich so eine Höhenlage. Es war, als ob man durch einen Strohhalm atmen muss. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”21496″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Erste Symptome…” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Am nächsten Morgen drückte das Tageslicht auf meine Augen. Ich hab kaum geschlafen und schleppte mich zum Frühstückstisch. Altes Toastbrot. Und Rühreier, die so erbärmlich schmeckten, dass mir sofort schlecht wurde. Das Wetter war brillant, aber mir ging es nicht gut. Diese verdammten Eier. Es ging los. Heutiges Tagesziel war das Bergdorf Pheriche auf 4.240m. Geschwächt setzte ich einen Schritt vor den anderen. Bei der ersten Frage meines Sherpas nach nur zehn Minuten blockte ich ab. Bei seiner zweiten Frage nach 30 Minuten legte ich ein Geständnis ab. [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”…ignoriert.” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Ich wusste ganz genau was es bedeutet, wenn Dir in dieser Höhe schon so schlecht ist und man weiter aufsteigt. Ich wusste aber auch, dass ich mir heute aufgrund der geringen Distanz viel Zeit lassen kann und für morgen immerhin ein kompletter Ruhetag eingeplant war. Außerdem musste es ja keine Höhenkrankheit sein. Vielleicht hat es auch an den schlechten Eiern liegen können? Diese verdammten Eier. Ich torkelte also weiter. Hin und her. Bis ich auf 4.300m das erste Mal zusammenbrach. Nur noch 57% Sauerstoffgehalt. Eine halbe Stunde blieb ich so im Gras liegen. Von hier konnte ich Pheriche sehen. Nur 1 Kilometer entfernt. Unter großem Kopfweh, Schwindel und Übelkeit richtete ich mich wieder auf. Meine größte Motivation war nur noch ein Bett und die Aussicht auf 1,5 Tage Nichtstun. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”994″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Lebensgefahr” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Im Bergdorf Pheriche angekommen konnte ich schon nicht mehr aufrecht stehen. Rapider Leistungsabfall. Mein Sherpa musste mich zur Unterkunft stützen, wo er mich gleich ins Bett brachte. Jetzt begann das Frieren und Zittern. So heftiger Schüttelfrost, dass mein Holzbett quietschte. Weitere zwei Decken schafften keine Abhilfe, obwohl ich schweißgebadet war. Und es wurde schlimmer. Schweres Kopfweh. Übelkeit. Mein Körper war so müde, dass ich nicht einmal den Arm heben konnte. Trotzdem erhöhte sich der Puls. Nach einer Weile kam Husten dazu. Zwischenzeitlich hatte ich sogar Herzrasen. Und immer wieder musste ich nach Luft ringen: Atemnot, obwohl ich seit mehr als einer Stunde im Bett lag und entspannt sein sollte.[/vc_column_text][vc_column_text]Dann. Endlich. Endlich höre ich meinen Sherpa draußen im Holzflur zu meinem Zimmer stapfen. Ich brauchte dringend Hilfe. Doch als er die Tür öffnete, erschrak er: „Michael, Du hast blaue Lippen!“ Die Angst packte mich. Todesangst. Ich wusste, was blaue Lippen bedeuteten. Eine akute Zyanose bedeutet eine lebensbedrohliche Unterversorgung des Blutes mit Sauerstoff und könnte ein Anzeichen für ein Lungenödem sein. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”21548″ img_size=”large” add_caption=”yes”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Keine Rettung von oben” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Es gab nur einen Weg, um lebend aus dieser Situation heraus zu kommen. Runter, runter, runter. „Hubschrauber. Ruf an“, sagte ich zu ihm. Sofort telefonierte mein Sherpa nach Kathmandu. Als er auflegte hatte er jedoch furchtbare Neuigkeiten: Kein Hubschrauber könne aktuell unter diesen Bedingungen auf mehr als 4.000m hinauf fliegen. Ungläubig blickte ich aus dem Fenster. Tatsächlich. Vorher schien mir die Sonne ins Gesicht. Und jetzt: dichter Nebel. Einfach unglaublich. Keine 20 Meter weit konnte man sehen und es wurde dunkel. [/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Überlebenswille” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Den nächsten Gedanken wollte ich nicht zu Ende denken. Noch einen Tag hier zu verbringen und in akuter Lebensgefahr ohne Hilfe und auf besseres Wetter zu hoffen hätte meinen Tod bedeutet. Das wusste auch mein Sherpa. In dem Moment, als ich den Nebel und die eintretende Dunkelheit durchs Fenster sah, sprang ich wie von einer Biene gestochen aus dem Bett und zog meine Schuhe an. Ohne nachzudenken. „Runter. Schnell.“ Mein Leben hing davon ab. Der Sherpa lud nun seinen und meinen Rucksack auf Brust und Rücken. Mit dem linken Arm hielt er eine Taschenlampe, mit dem rechten Arm stützte er mich. Als wir die Hütte verließen sah ich nichts. Nebel und Dunkelheit. Ich konnte mich jetzt nur auf die Orientierung meines Bergführer verlassen. Vor lauter Schwäche stürzte ich immer wieder zu Boden. Mehrmals musste ich mich übergeben. [/vc_column_text][vc_column_text]Zwei Stunden mussten vergangen sein, als wir schließlich vor einer Hütte Halt machten, wo uns eine alte Frau schon erwartete. Mein Sherpa sagte, dass wir es auf 3.900m geschafft haben und hier die Nacht verbringen. Die Frau zog mir die Stiefel aus, steckte mir ein Fieberthermometer zu und brachte heiße Knoblauchsuppe. Das sei die beste Medizin für jemand wie mich, meinte sie. Drei Löffel. Mehr schaffte ich nicht. Meine Körpertemperatur lag bei 40,7°. Die beiden brachten mich ins Bett und ich schlief ein.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Außer Lebensgefahr” font_container=”tag:h2|text_align:left|color:%23000000″ use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]05.00 morgens. Mit halboffenen Augen erkannte ich meinen Sherpa mit einer heißen Knoblauchsuppe an meinem Bett: „Wach auf. Wir müssen weiter absteigen. Du musst das essen.“ Noch immer hatte ich Schüttelfrost. Aber diesmal schaffte ich die Hälfte der Knoblauchsuppe. Gutes Zeichen. Es ging los. Wir brauchten fast den ganzen Tag hinunter nach Namche Bazar auf 3.400m. Endlich eine Höhenlage, wo mein Körper regenerieren konnte. Hier gab’s im Vergleich zu gestern Abend bereits 10% mehr Sauerstoffgehalt in der Luft. Durch die enormen Anstrengungen bekam ich abends wieder hohes Fieber, Schweißausbrüche und Schüttelfrost. Aber ich schlief die ganze Nacht durch. [/vc_column_text][vc_column_text]Am nächsten Morgen ging es mir besser. Den ganzen Tag verbrachte ich im Bett. Am dritten Tag war ich wieder gesund. Noch heute habe ich keine Ahnung, wo ich diesen plötzlichen Energieschub in meinem Holzbett in Pheriche aus meinem Körper geholt habe. Eine Urkraft. Aber wie stark man ist, erfährt man wohl erst dann, wenn Starksein die einzige Option ist, die man hat.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
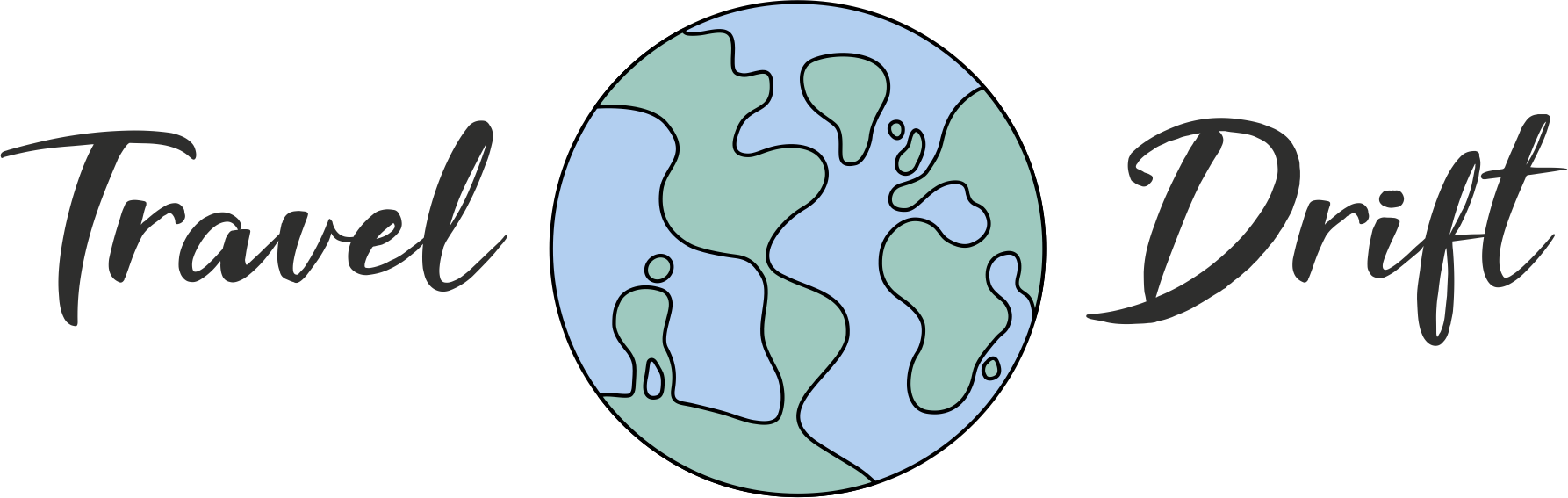





Leave A Comment